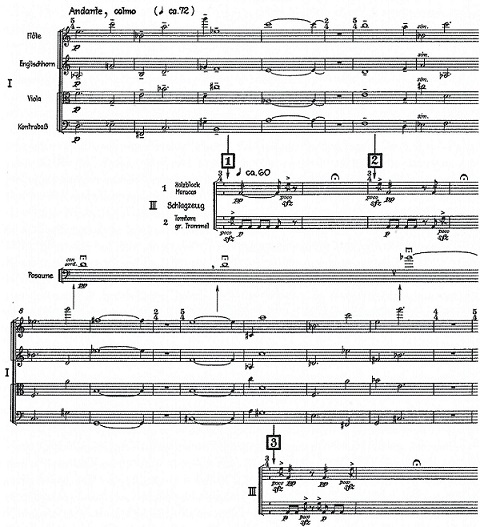
(S. 148) Die Relationen zu sich
selbst, zueinander und zur Welt, das
heißt die permanente Interdependenz, sind Gegenstand der
folgenden Abhandlung. Dabei gilt uns der Begriff
„Gemeinschaft“ nicht als konkrete Teil-Form des
gesellschaftlichen Lebens, sondern lediglich als Gestaltungsaspekt
einer Trichotomie von Individuum, Gemeinschaft und Gesellschaft.
Individuum: Jeder einzelne Instrumentalist des Orchesters wird von uns
als Individuum gesehen, als vom Komponisten zwar gesteuerte, jedoch
handelnde Person in der Wiedergabe seiner Stimme im Orchester, sobald
er exponiert in Erscheinung tritt. Insbesondere gilt aber der Solist
eines Solokonzertes als ein herausragendes Individuum kraft seiner
überragenden Fähigkeiten und seiner
ausgeprägten Persönlichkeit.
Gemeinschaft: Max Weber (2010, Wirtschaft und Gesellschaft. Frankfurt/M.; S. 29), der von
„Vergemeinschaftung“ spricht, lieferte in seinem
grundlegenden Werk über die Entstehung und Wirkung politischer
und ökonomischer Macht folgende Definition:
„»Vergemeinschaftung« soll eine soziale
Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des
sozialen Handelns – im Einzelfall oder im Durchschnitt oder
reinen Typus – auf subjektiv gefühlter (affektueller
oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der Beteiligten
beruht.“
Als eine Gemeinschaft wollen wir das Orchester ansehen mit den
unterschiedlichen instrumentalen Großgruppen:
Holzbläser, Blechbläser, Streicher, Schlagwerk etc.,
die wiederum aus den kleineren Instrumenten-Gruppen bestehen:
Flöten, Oboen, Klarinetten, Hörnern, Trompeten,
Violinen etc.
Wir wollen unter dem von Ferdinand Tönnies
begründeten, soziologischen Konzeptbegriff Gemeinschaft
– aufgrund der affektiven Nähe der
Orchestermitglieder zueinander und die besonders enge, zielorientierte
Verbundenheit dieser Individuen, deren Beziehungsformen und
Ordnungsvorstellungen auf eine emotional-geistige Einheit ausgerichtet
sind – ein Beziehungsverhältnis verstehen, das
sowohl vom „Wesenswillen“ (dem Handeln aus innerem
Antrieb) als auch vom „Kürwillen“ (dem
Handeln aus äußeren Zielsetzungen) geprägt
ist (F. Tönnies 1887, Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig, S. 100).
„Jeder handelt für das gemeinsame
Beziehungsverhältnis.“ (R. Hettlage 1989, Gemeinschaft, in:
Wörterbuch der Soziologie, hrsg. von G. Endruweit, G.
Trommsdorf, Stuttgart S. 232)
Gesellschaft: „Der Gesellschaftsbegriff ist immer Teil einer
Theorie des menschlichen Zusammenlebens, als theoretischer Begriff
immer abhängig von der sozialen Realität der
Gesellschaft als seiner Praxis.“ (Rammstedt 1988,
Gesellschaft [2], in: Lexikon zur Soziologie, hrsg. von W. Fuchs, R.
Klima, R. Lautmann, O. Rammstedt, H. Wienold, Opladen S. 267)
Die neuere Soziologie sieht die „Gesellschaft als Summe von
Individuen, die durch ein Netzwerk sozialer Beziehungen miteinander (S.
150) in Kontakt und Interaktion stehen.“ (H. Wienold 2/1978,
Gesellschaft [3] u. [5], in: Lexikon zur Soziologie, hrsg. von W.
Fuchs, R. Klima, R. Lautmann, O. Rammstedt, H. Wienold, Opladen, S.
268) Geht man also davon aus, dass Gesellschaft ein Netzwerk sozialer
Beziehungen von Individuen ist, dann ist die Untersuchung dessen, was
Gesellschaft genannt werden soll, eine “Untersuchung der
Formen und Strukturen“ ihrer Beziehungen.
Der Soziologe Max Weber (1864-1920) bezeichnet die gesellschaftlichen
Beziehungen, aus deren Summe die Gesellschaft entsteht, mit dem Begriff
des sozialen Handelns, das dadurch gekennzeichnet ist, dass sein vom
Handelnden gemeinter Sinn immer auf das Handeln anderer bezogen ist und
durch diese Orientierung gesteuert wird.“ (Wienold 2/1978, S.
268) Für Max Weber soll
»Vergesellschaftung« „eine soziale
Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des
sozialen Handelns auf rational (wert- oder zweckrational) motiviertem
Interessenausgleich oder auf ebenso motivierter Interessenverbindung
beruht.“ (Weber 2010, S. 29) Der 1902 in Colorado Springs
geborene Soziologe Talcott Parsons definiert „Gesellschaft
als die Kollektvität (= soziales System mit gemeinschaftlicher
Wertorientierung und Handlungsfähigkeit), die alle
erhaltungsnotwendigen Funktionen in sich erfüllen kann
[…].“ (Luhmann 2/1978, Gesellschaft [4], in:
Lexikon zur Soziologie, hrsg. von W. Fuchs, R. Klima, R. Lautmann, O.
Rammstedt, H. Wienold, Opladen, S. 268) In kulturanthropologischen
Theorien wird „Gesellschaft als Gruppe von Individuen
definiert, die sich durch eine gesonderte Kultur (Wertsystem,
Tradition) auszeichnet und unabhängig von anderen
Gruppierungen ist (nicht Untergruppe einer anderen Gruppe). Bestimmend
für die sozialen Beziehungen ist das Hineinwachsen des
einzelnen in die durch Kultur angebotenen Orientierungen und
Handlungsformen.“ (Wienold 1978, S. 268). Nach Luhmann ist
Gesellschaft das umfassendste Sozialsystem. (G. Kneer/A. Nassehi
4/2000, Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, München, S.
111)
Für Ulrich Beck zeichnete sich bereits in den 60er Jahren der
„Anfang eines neuen Modus der Vergesellschaftung“
ab und nahm „eine Art »Gestaltwandel« im
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft“ an, er
nennt diesen Gestaltwandel »Individualisierung«.
Und diese Gesellschaft, in der dieser Wandel zum Ausdruck kommt,
bezeichnet er als »Risikogesellschaft« (Beck 1986,
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am
Main).
(S. 151) Der Mensch ist aufgefordert,
die individuellen Entscheidungen für sein Leben selbst zu
treffen, doch Institutionen und Regelungen, Moden und Erwartungen
lenken oder zwingen ihn mit seinen Entscheidungen in eine bestimmte
Richtung. Zur „Entzauberung“ haben in ganz
entscheidendem Maße die Medien beigetragen mit der
Darstellung der Fülle des Lebens, was zu dem Schluss
führte, dass das Individuum allein auf sich vertraute und
alles selbst entscheiden und vor anderen rechtfertigen musste. Zu einem
solchen Verhalten sind die Individuen bei diesem
Mentalitätswechsel naturgemäß sehr
unterschiedlich in der Lage. Wer aber in den Wandel eingreifen will und
ihn nicht nur konstatiert, der muss das Machbare denken oder wie
Bernard Shaw es formuliert haben soll: ‚wir dürfen
die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern wie sie sein
sollen.‘ Doch diese Spannweite ist groß, wenn man
an Pastor Lorenzens Worte in Fontanes Stechlin von 1899 denkt:
„Jedes höher gesteckte Ziel, jedes Wollen, das
über den Kartoffelsack hinausgeht, findet kein
Verständnis.“ (Fontane 1983, Werke in fünf
Bänden, Bd. 5: Der Stechlin, Berlin und Weimar, S. 394)
Jedes Individuum wird in ein bestimmtes Denken und Handeln
hineingeboren, in eine Gesellschaft, deren Denken und Handeln aufgrund
bestimmter Überzeugungen und Regelungen, wie eine Welt sein
sollte und wie sie tatsächlich ist, mehr oder weniger
festgelegt ist.
Dieses normierte Denken und Handeln, das außerhalb des
Individuums steht, das sind gewissermaßen die Sedimente, die
moralischen Gebote, die öffentliche Meinung, die Normen des
Rechts unseres gesellschaftlichen Lebens, sie sind das
Kollektivbewusstsein. Diese Regulierung und Gesetzgebung empfindet das
Individuum nur dann als Zwang, wenn es sich mit den gesellschaftlichen
Konventionen, „die uns im Prozess der Sozialisation als ganz
selbstverständlich nahe gebracht werden“ (Abels
2007, Einführung in die Soziologie, Bd. 1: Der Blick auf die
Gesellschaft, Wiesbaden, S. 143), nicht identifizieren kann.
Den Prozess des alltäglichen Aufnehmens und Annehmens der
sozialen Tatsachen nennt Durkheim Internalisierung und substituiert den
früheren Begriff „faits sociaux“ für die durch die
Gesellschaft festgesetzten Verhaltensweisen durch „Institutionen“.
„Tatsächlich kann man … alle
Glaubensvorstellungen und durch die Gesellschaft festgesetzten
Verhaltensweisen Institutionen nennen; die Soziologie kann also
definiert werden als die Wissenschaft von den Institutionen, deren
Entstehung und Wirkungsart.“ (Durkheim 3/1970, S. 100). Das
Annehmen dieser Institutionen ist zum einen dem sozialen Zwang
geschuldet und zum anderen ist damit aber auch die Anerkennung
verbunden, die das Individuum bei Konformität findet.
„Solange Alternativen des Handelns nicht bekannt sind, wird
in der Tat (S. 152) mancher den »zwingenden
Charakter« der sozialen Tatsachen nicht empfinden.“
(Abels 2007, S. 144) Das Sich-Verdichten von wiederholten Handlungen zu
Modellen weiteren Handelns bezeichnen Berger und Luckmann als
Habitualisierung, wiederholt erfolgreiches Verhalten wird zu typischem
Verhalten generalisiert, solche Muster werden zum Habitus. Derartige
habitualisierte Prozesse führen zur Institutionalisierung.
Dieser wohl eher dynamische Begriff deutet an, „dass das
Individuum sich seiner Mitwirkung an der gesellschaftlichen
Konstruktion der Wirklichkeit immer bewusst bleiben – und sie
einfordern – muss.“ (Abels 2007, S. 169) (S. 153)
„Institutionen sind geronnene Kultur. Sie transformieren
kulturelle Wertorientierungen in eine normativ verbindliche soziale
Ordnung. Institutionen sind Ausdruck einer den Menschen
gegenübertretenden Macht.“ …
„Institutionen sind Ideen über die Welt“.
Wenn also ein Komponist wie Friedrich Goldmann, der engagiert und
kritisch die konstruktiven Ergebnisse solcher kompositorischen Prozesse
– der spezifisch widerspruchsvollen inneren
Kontinuität des kompositorischen Fortschreitens wie
hinsichtlich der Dialektik von nationalem und internationalem
Kunstprozess einschließlich ihrer gesamtgesellschaftlichen
Bedingungen und Auswirkungen verarbeitet – in seiner
schöpferischen Produktion bewusst auf die
Verhältnisse in der Gesellschaft und den jeweiligen Zustand
ihrer Musikkultur reagiert (Schneider 1979, S. 84), dann bedeutet das
ein kritisches Untersuchen der Feststellungen des Wissens, eben dieser
„Institutionalisierung“ der Wirklichkeit.
Das Individuum – die
Gemeinschaft
In jedem Menschen besteht „gleichsam eine
unveränderliche Proportion zwischen dem Individuellen und dem
Sozialen [...], die nur die Form wechselt: je enger der Kreis ist, an
den wir uns hingeben, desto weniger Freiheit der
Individualität besitzen wir; dafür aber ist dieser
Kreis selbst etwas Individuelles, scheidet sich, eben weil er kleiner
ist, mit scharfer Begrenzung gegen die übrigen ab.“
(Simmel 3/1989, Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl, hrsg. v. H.-J. Dahme und O.
Rammstedt, Frankfurt/M., S. 56) Eine solche Situation ist sehr schön zu
beobachten im Oboenkonzert, vor allem aber im Klavierkonzert, wo der
Pianist mit solistischen Instrumenten des Orchesters dialogisiert,
wodurch der Situation etwas Privates, eng miteinander Verbundenes,
nahezu Intimes anhaftet. „Und umgekehrt: erweitert sich der
Kreis, in dem wir uns betätigen und dem unsre Interessen
gelten, so ist darin mehr Spielraum für die Entwicklung unsrer
Individualität …“ (Simmel 3/1989,
Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl, hrsg. v. H.-J. Dahme und O.
Rammstedt, Frankfurt/M., S. 56) Jedes Tun und Handeln eines sozialen
Individuums wirkt „auf andere Gebilde ein und wird von ihnen
bewirkt. Das ist gemeint, wenn man die Ordnung als Prozess
versteht.“ (Abels 2007, S. 104) Wenn wir diesen
soziologischen Prozess nun auf unser Modell Solist –
Orchester übertragen, dann unterscheiden wir:
• den Solisten in seiner Individualität mit der
Wirkung auf das Orchester oder auf Teile desselben bzw. die
Veränderung des Verhaltens des Solisten als Folge
entsprechender Rückkopplungswahrnehmung,
• den Solisten in der gelegentlichen Eingebundenheit in
kleinste Kreise (etwa im kammermusikalischen Posaunenkonzert oder die
Kommunikation, das Konzertieren mit wenigen
„Individuen“ aus dem Orchester in den anderen
Konzerten), also die engen Kreise von Teilen der Gemeinschaft, den
Gruppen mit ihrer deutlichen Abgrenzung gegenüber den anderen,
und
• die Ausweitung des Spielraums für den Solisten
aufgrund des erweiterten Kreises (gesamtes Orchester) bei
verstärktem sozialen Interesse der Gemeinschaft (etwa im
Oboenkonzert).
Das Anfangen steht –
zumindest in den Konzerten für Posaune, Violine und Klavier
– unter der Prämisse von Sein – Sich aber
noch nicht haben – und darum Werden müssen, das
heißt, erst ganz am Ende dieser Hörereignisse wird
sich herausgestellt haben, was Goldmann wirklich zu sagen hatte; oder
wie Peter Sloterdijk es im Nachwort zu „Die Geburt der Tragödie
aus dem Geiste der Musik“ von Friedrich Nietzsche formuliert:
„Das Spiel setzt ein, als wolle der Spieler sagen: Ich bin da
– aber ich habe mich noch nicht; darum muß ich
werden. Ich wette also darauf, dass sich im Laufe der Vorstellung
herausstellen wird, was ich wirklich zu sagen hatte.“
(Sloterdijk 2000, S. 200)
Konzert für Posaune und drei Instrumentalgruppen
Ein Charakteristikum im Posaunenkonzert ist das wechselnde Dominieren
der Gruppen und des Solisten. Dieses Konzert ist nicht für
einen Virtuosen im landläufigen Sinne geschrieben, sondern
für einen speziellen Instrumentalisten der Leipziger Gruppe Neue Musik »Hanns-Eisler«.
Solisten sind sie, die Musiker der Gruppe,
allesamt; insofern ist der Posaunist hier nicht mehr als ein Gleicher
unter Gleichen, vom Komponisten „isoliert“ als
Solist, doch nicht die Komposition permanent dominierend oder gar den
dramaturgischen Ablauf entscheidend
„führend“. Aber mit der Auswahl des
Instruments … charakterisiert Goldmann vielmehr die
Individualität der zum Solisten ernannten Person, für
die das Konzert geschrieben wurde, den Komponistenkollegen (und
Posaunisten) Friedrich Schenker und dessen zu dieser Zeit
hochexpressionistisches Denken in Bezug auf die kompositorischen
Strukturen, die sich oft an der Grenze des physisch Machbaren und
psychisch Verkraftbaren bewegen. Goldmann kommt hier dem Denken, der
Mentalität Friedrich Schenkers sehr weit
entgegen. Auffällig ist auch die introvertierte bzw. sehr
zurückgenommene (pp) Dominanz des Solisten in den
Ecksätzen des Violinkonzertes und im Gegensatz dazu die a
priori führende, virtuose Dominanz demonstrierende Solo-Oboe
vor allem im ersten Satz des Konzertes für Oboe und Orchester
oder der eigen-unartig demokratisch sich gebärdende Solist im
Klavierkonzert, der nicht mehr virtuoser Solist sein möchte
oder in diesem Umfeld sein kann, sondern versucht, sich in ein Netzwerk
von unterschiedlichsten Beziehungen einzubinden.
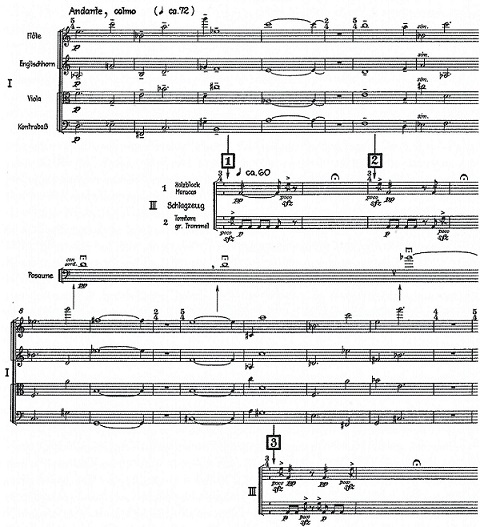
Konzert für Posaune und drei Instrumentalgruppen (1977)
NB 1: Beginn Teil I (Partitur T 1-15).

Konzert für Violine und Orchester (1977)
NB 4: Beginn des I. Satzes, „Partitur“ und Solo-Violine (T. 1-10)
(S. 161) Die drei Konzerte mit
Orchester für Violine, Oboe und Klavier weisen sehr
unterschiedliche Ausprägungen auf, die zuweilen bis hin zum
scheinbaren Auseinanderbrechen reichen.
Konzert für Violine und Orchester
Bereits die Aufstellung der 35 Musiker des Orchesters bei der Uraufführung des Konzertes
für Violine und Orchester – im offenen Ring um den
Solisten und Dirigenten gruppiert – macht optisch den
Gegensatz des dann musikalisch aufgedeckten Problems deutlich,
nämlich wie isoliert das Individuum geführt wird. Wie
wir im Oboenkonzert gesehen haben, übt sich Goldmann in der
Variationstechnik (wir haben dabei stets mehr den Begriff
„Veränderung“ im Blick), dabei
möglichst viele Parameter einbeziehend.
Mit einem ausgedehnten Monolog leitet der Solist vor dem Hintergrund
einer Geräuschkulisse von Maracas, Großer Trommel und
Tamtam im pp den „Geburtsvorgang“ des
Violinkonzertes ein. Zaghaft (pp) und in Septimensprüngen
sucht der Solist nach seiner Ausdrucksform. Er steht
gewissermaßen vor einer Tabula rasa, Eindrücke vom
Orchester konnte er noch nicht aufnehmen. Die weiten Intervalle wirken
ziellos. In der ersten Variation (Veränderung, T. 2/3) sind
die 6 Dauern bzw. 12 Töne numerisch organisiert; die Tonfolgen
bilden Dreiergruppen in weitgespannten Intervallen: f-g-fis / cis-h-c / g-f- /c-h-cis / fis.
(S. 162) Wie unsichere Atemübungen wirken die ersten drei Versuche der Solo-Violine in NB 4, die sich jeweils aus zwei permutierten Dauernfolgen (6,1,5,2,4,3 - 1,6,3,4,2,5 Sechzehntel im Takt 2) organisieren.
(S. 164) Der Solist versucht in sechs
Einsätzen (Varianten) vergeblich, sich gegen die Klangmasse
Gehör zu verschaffen. Das Individuum scheint ohne jegliche
existentielle Chance, wenn Massen so undifferenziert und kompakt
daherkommen bzw. wenn derartig unterschiedliche Handlungsstrukturen
aufeinanderstoßen. Wie ein neuer Anfang wirkt daher das Spiel
der Solovioline im folgenden Andante mit seinen zwei Varianten (T. 42
u. 44), die wiederum nur von den Geräuschen der
Schlaginstrumente begleitet werden.
Aus einem Klangfeld heraus, das durch Triller und Tremoli einen nahezu
instabilen Charakter erhält, verschafft sich der Solist mit
Doppelgriffen im ff (Tritonus, große Septime, kleine Terz,
kleine Sexte) Gehör. Und es scheint, als wollten drei Violinen
I solo als versöhnliche Geste einen Kanon anstimmen (T. 62-67)
mit Intervallen respektive Motivgesten des Solisten, vgl. NB 13, obere
Zeile: Solovioline, darunter drei Violinen I solo (T. 62-63).

Konzert für Violine und Orchester (1977)
NB 13: 3 Violinen mit dem kanonartigen Einsatz (T. 62-63)
Mit dem Einsatz der Solo-Violine im
Takt 68 zieht sich das Orchester
nach und nach zurück und der Solist tritt befreit mit Gesten
hervor, die wir dann im Oboenkonzert wiederfinden werden.
Wie angstgehetzt in einem Alptraum
klingen jetzt die flirrenden Tremoli des Solisten mit ihren
raumgreifenden Septimensprüngen (T. 76: fff feroce –
presto, senza misura). Der Solist findet im T. 77 das
„In-der-Welt-Sein“ im pp mit sanften, melodisch
abwärts geführten Gesten wieder (andante), die sich
im dreifachen ppp zu verlieren scheinen und mit einem Pizzicato auf dem
höchstmöglichen Ton enden (im p T. 80).
Der nachfolgende Abschnitt eröffnet im T. 81 eine ganz neue
‚Handlung‘. Verschiedene Individuen (Fl., Ob., Eh., Klar., Tr., Hr.)
konzertieren quasi solistisch in einer Gemeinschaft unter Gleichen. Der
Solist aus der Gemeinschaft wechselt die
Instrumente, es ist quasi die Illusion eines ausgeglichenen,
konzertanten, kammermusikalischen Miteinanders, denn die Idylle
hält nicht lange an. Noch ein drittes Mal wälzt sich
das kontrapunktisch diffuse Gewebe des Orchesters, wo jede
Instrumentengruppe ihren eigenwilligen Beitrag zu leisten scheint, in
den nachfolgenden Akkorden dahin (Partitur T. 111-114). (S. 167) Doch
diesmal bleibt Raum für den Solisten, der sich gegen die
bedrohlichen Klangmassen souverän gestemmt hat. Dann aber
nimmt der Satz überraschenderweise ein geradezu
kapriziöses Ende mit der Quinte über dem Anfangston
(vgl. S. 157, NB 4, Takt 2). (S. 168) Von Beginn an ist die Solovioline
in ihren Solopassagen (T. 2ff., T. 42ff., T. 77ff., 121ff.) stets mit
den pp-Geräuschen der Schlagzeuggruppe (Maracas/Holzblock,
Große Trommel, Tamtam) verbunden als eine Art
Umweltgeräusch, aus dem alles Mögliche hervorbrechen
könnte und das dadurch auch eine gewisse Spannung aufbaut oder
zumindest eine Erwartung schürt. Während das
Schlagzeug in den Abschnitten in denen es die Soli des Violinisten
begleitet durch Wirbeltechnik ein permanentes pp-Geräusch
erzeugt und auch in den wenigen numerisch gesteuerten
Anschlägen am Schluss des ersten Satzes im pp verbleibt,
agiert es in den Orchesterabschnitten mit deutlich stärkerer
Dynamik vom pp bis hin zum ff und sffz in den Takten 73-75 und verleiht
dem Geschehen eine dunkle Dramatik.
Ein Formteil im ersten Satz bedarf
noch der besonderen Erwähnung, da er stärker auf eine
Gemeinschaft von Individuen aufbaut und sich in einer anderen Welt zu
befinden scheint als die Orchesterabschnitte mit ihrer eher
undurchsichtigen, wenig differenzierten Massenbewegung.
Möglicherweise sind es soziologisch diese drei Existenzformen
im ersten Satz des Violinkonzertes, die Goldmann bei der Konzeption
dezidiert im Auge hatte: die Masse des Orchesters als die Gemeinschaft,
die kammermusikalisch musizierende Gruppe (als Gruppe in der
Gemeinschaft) sowie den Solisten, das Individuum.
(S. 170) Die „Einsamkeit des Sologeigers“ (wie ein
Rezensent schrieb) scheint sich auf die Gesellschaft zu beziehen,
weniger auf die Gemeinschaft, als die wir das Orchester definiert
haben, denn Teile des Orchesters, also Orchestergruppen (vornehmlich
die Bläser) arrangieren sich durchaus mit dem vom Solisten
eingespielten Gedankenmaterial. Resignation war Goldmanns Eigenschaft
nicht …
(S. 183) „Es muss leicht
sein, heroisch zu empfinden, wenn man von Natur unempfindlich ist, und
in Kilometern zu denken, wenn man gar nicht weiß, welche
Fülle jeder Millimeter verbergen kann.“ (Musil
26/2011, S. 63) Es sind keine Abbilder, die uns Goldmann liefert,
sondern Inbilder seines Lebens. Ein Komponist ist Handelnder und
zugleich immer auch Beobachter seines Handelns.
Konzert für Klavier und
Orchester – Acht Sectionen
(S. 186) Wir werden sehr schnell feststellen, dass in diesem Konzert
alles „Variation“ ist. Doch vielleicht sollten wir
besser sagen „Veränderung“ – wie
unseres Erachtens im Klavierkonzert –, wo man, wie Musil 1978
schrieb, ständig das Gefühl hat, das Ganze gliche
„einem Mann, den ein unheimlicher Wandertrieb
vorwärtsführt, für den es keine
Rückkehr gibt und kein Erreichen …“ (R.
Musil 26/2011, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbek, S. 234) Fast alle
der acht Sectionen hinterlassen den Eindruck, als seien sie
Aufblendungen auf eines im Fluss sich befindenden Ereignisses, eines
Ablaufes, dessen Formung zwar erkennbar, aber nicht in jeder Phase
zwingend ist. Die variablen Binnenstrukturen erlauben durchaus auch
andere Fortschreitungen, freilich aber sind es dann nicht mehr die
Sinngebungen des Komponisten. Der Solist entfernt sich weit vom
traditionellen Solokonzert, auch wenn er gelegentlich nach Dominanz
strebt, so bleibt er doch im Wesentlichen ein Musizierender innerhalb
der Gemeinschaft des Orchesters respektive ein Konzertierender mit
einzelnen Gruppen oder einzelnen Instrumentalisten. Nur selten stellt
sich der Solist virtuos wirklich heraus, seine Kommunikationsform ist
nicht hierarchisch angelegt, er ist Anreger und Empfänger
gleichermaßen, sozial geprägt von einem gewissen
Kollektivbewusstsein. Doch „neben der Offenbarkeit des Sinns
für den Handelnden steht gleichursprünglich
für den Analytiker die Undurchsichtigkeit […] des
sozialen Zusammenhangs…“ (Durkheim 3/1970, Die
Regeln der soziologischen Methode, Neuwied, S. 65).



Konzert für Klavier und Orchester (1979)
NB 44: Section 1, 1. Abschnitt: kleine Terz mit E in den Pauken (T. 1-16), vgl. Annäherung 3, NB 13
(S. 190) Das Ritual der Geburt von
etwas Kunstartigem ist in der ersten Section ausgebreitet und die
Initiation ist vollzogen. In den folgenden Sectionen erfolgen die
Vorstöße ins weite Feld der unendlichen Vielfalt von
kontingent-thematischen Veränderungen und in eine
Formenvielfalt, die mal mehr mal weniger ihre Tradition in Erinnerung
bringt.
(S. 225) Der Begriff Kontingenz ist
zeitdiagnostisch von großer Relevanz. Die Erfahrung
zunehmender Orientierungslosigkeit einerseits und das erstarkende
Subjekt andererseits bilden heute eine scheinbar nur schwer
überbrückbare Kluft und ein zunehmendes Risiko.
Kontingenz wird „als eine dem Handeln eigene Chance
verstanden“, die sie „in eine Figur der Freiheit
verwandelt.“ (K. Palonen, Das ‚Webersche
Moment‘. Zur Kontingenz des Politischen, Opladen 1998, S. 15)
Da Handeln Selektion bedeutet, also eine zu treffende Entscheidung bei
mehreren gegebenen Möglichkeiten ist, folgt daraus, dass es
eine Entscheidung für diese eine Möglichkeit ist
gegen alle anderen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage,
welches Kriterium zu eben dieser einen Entscheidung führt.
Aristoteles sah in der Erfahrung ein solches Kriterium.
Goldmanns
„Figuren“, die Solisten seiner Konzerte, konnten
unterschiedlicher kaum konstruiert und dramatisiert werden; ihre
Chiffrierungen deuten auf Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens.
Die Erfahrung lehrt, dass jede Handlung für den Handelnden
eine mehr oder weniger gut zu bewältigende Herausforderung
darstellt. Goldmanns kompositorische Ereignisse sind in weiten
Bereichen Handlungen, die aus einem Entscheidungskontext resultieren.
Doch ein bestimmtes Handeln setzt grundsätzlich voraus, dass
es überhaupt einen Spielraum offener Möglichkeiten
gibt, denn Handeln „bedeutet Setzen von Wirklichkeit, die
noch nicht ist.“ (R. Bubner 1998, Die Aristotelische Lehre
vom Zufall. In: KONTINGENZ in der Reihe Poetik und Hermeneutik, hrsg.
von G. Graevenitz und O. Marquard, München, S. 7)
Wohl in jedem Menschen findet sich
eine mehr oder weniger austarierte Proportion zwischen dem
Individuellen und dem Sozialen. „Der Mensch hat eine Neigung
sich zu vergesellschaften, weil er in einem solchen Zustande sich mehr
als Mensch, d.i. die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt.
Er hat aber auch einen großen Hang sich zu vereinzelnen
(isolieren); weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft
antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen, und
daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich
selbst weiß, dass er seinerseits zum Widerstande gegen andere
geneigt ist.“ (I. Kant 1784, Idee zu einer allgemeinen
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Die Kritiken,
Frankfurt/M. 2008, S. 624) Je kleiner der Kreis ist, in dem Personen
miteinander kommunizieren, umso stärker wird ihre
Individualität eingeschränkt; dafür aber
wird dieser kleine Kreis etwas Besonderes, etwas Individuelles und
zeichnet sich deutlich gegenüber anderen ab. Wir empfinden
solche Situationen stets als etwas eher Privates, wenn der Solist mit
einem Orchesterinstrument dialogisiert oder mit einer kleinen Gruppe
des Orchesters konzertiert. Unsere Aufmerksamkeit fokussiert sich
augenblicklich auf dieses intime akustische Geschehen. Solokonzerte
sind soziologisch ein Phänomen, darüber zu
reflektieren sollte legitim sein, auch wenn das Thema unter
soziologischen Aspekten in dieser
„Annäherung“ einen ausgesprochen ideellen
Charakter hat.
(S. 226) Eine Gemeinschaft, so lässt sich vielleicht in unserem Fall sagen, entsteht bei der Verwirklichung von durch Kooperation geleisteter Dienste. Die unmittelbare Zusammenarbeit im Orchester und die zielführende Realisierung von Aufführungen im Konzert, in der Oper oder sonstiger in Verbindung mit dem Orchester erfolgenden Veranstaltungen, bewirken eine Vergemeinschaftung, ihre Einheit liegt in dem intendierten Ergebnis, das durch einzelne Musiker nicht hergestellt werden könnte. Derartige Dienste leistet die Gemeinschaft (das Orchester) für die Gesellschaft. Exponierte Aufführungen oder musikalische Veranstaltungen sind in unserem Sprachgebrauch „gesellschaftliche Ereignisse“. Gemeinschaften sind Glieder, soziale Bausteine der Gesellschaft. Der Orchestermusiker ist als Teil der Gemeinschaft die kleinste unteilbare Einheit, eben das Individuum. Im Unterschied zum real agierenden Solisten ist sein Operationsfeld die Gemeinschaft. Der Solist vertritt als handelnde Person, als mehr oder weniger dominanter Charakter, seine Interessen sowohl gegenüber der Gemeinschaft – das wurde zum Beispiel im ersten Satz des Oboenkonzertes, aber auch im Violinkonzert sehr deutlich – wie auch gegenüber der Gesellschaft, etwa durch eine eindrucksvolle Interpretation seines schwierigen Parts. Andererseits aber verschließt er sich in kooperativem Sinne nicht dem Konzertieren mit Gleichgesinnten, etwa wie im Allegretto-Abschnitt des Violinkonzerts.